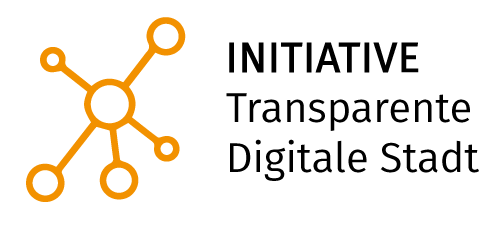Vom Geräusch zur Kooperation: Erst gab es Input und dann gute Diskussion. Am 18.09.2025 fand das erste Onlineseminar statt und brachte Bürger, Experten und Stadtwerke zusammen. Die INITIATIVE Transparente Digitale Stadt (I-TDS) lud zum ersten Online-Seminar „SMART CITY VERSTEHEN“ rund um das Thema „Lärm messen“ ein. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie komplex das Thema ist und welche Chancen die Digitalisierung für eine bessere Lärmerfassung bietet.
Wie laut ist eigentlich zu laut? Was für den einen noch Hintergrundrauschen ist, empfinden andere bereits als störend. Lärm ist ein hochindividuelles Phänomen – und zugleich eine zentrale Herausforderung für Städte, die wachsen, dichter werden und immer stärker von Verkehr, Bauprojekten und Alltagsgeräuschen geprägt sind.
Wie das Ohr Lärm wahrnimmt: Zu Beginn führte Hörfachkraft Birte Filling, Co Gründerin von AKmira optronics in die Grundlagen ein: Das menschliche Ohr ist ein sensibles Organ, das auf Schwingungen in der Luft reagiert. Ab einer bestimmten Intensität oder Dauer können diese Schwingungen, also Schall, nicht nur störend, sondern auch gesundheitsschädlich werden. Dauerhafte Belastungen erhöhen nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen und Stress. Damit wird klar: Lärmschutz ist nicht nur eine Frage des subjektiven Empfindens, sondern auch der öffentlichen Gesundheit.
Wie Lärmmessung und Datenplattform zusammenwirken: Andreas Becker, Leiter IT-Architektur und Projektleiter bei den Stadtwerken Potsdam, zeigte anschließend, wie aus subjektivem Empfinden verlässliche Daten werden können. Mit Sensoren, die Schallintensitäten in Dezibel (dB) erfassen, lassen sich konkrete Messpunkte im Stadtgebiet einrichten. Bislang beruhen viele Lärmkarten, auch in Potsdam, noch auf rechnerischen Analysen und Modellierungen – sie bilden also keine Echtzeitwerte ab. Hier eröffnet die vorhandene Infrastruktur neue Möglichkeiten: Potsdam verfügt über ein LoRaWAN-Netz, das Sensoren energiesparend und flächendeckend betreiben kann. Die Messwerte könnten direkt in die Urbane Datenplattform eingespeist werden, sodass Bürgerinnen und Bürger wie auch Verwaltung auf einen Blick sehen können, wie sich die Geräuschkulisse im Stadtgebiet entwickelt. Damit entstehen jedoch auch neue Fragen:
• Welchen Nutzen haben die Daten für den einzelnen Bürger?
• Wer legt fest, wann es „zu laut“ ist?
• Und wie werden die Informationen in konkrete Maßnahmen, etwa in einen Lärmaktionsplan, übersetzt?
Wissenschaft trifft Praxis: Besonders spannend war der Austausch im Anschluss: Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft diskutierten 45 Minuten lang. Unter den Teilnehmenden war auch ein Mitarbeiter des Fachgebiets Technische Akustik der TU Berlin, der anbot, das Thema in studentischen Arbeiten zu vertiefen.
Solche Kooperationen zwischen Stadtwerken, Universitäten und Initiativen wie I-TDS sind ein wichtiger Schritt: Sie verbinden wissenschaftliche Analysen mit praktischer Umsetzung und eröffnen neue Möglichkeiten, urbane Lebensqualität messbar und gestaltbar zu machen.
Ein gelungener Abend: Für die Initiative war der Abend ein voller Erfolg. In nur eineinhalb Stunden wurde deutlich, wie vielschichtig das Thema „Lärm“ ist – von der Biologie des Hörens über die technische Messung bis zur Frage der Veröffentlichung. Die Teilnehmer bestätigten: Online-Seminare sind ein guter Weg, Bürgerinnen und Bürger, Fachleute und Verwaltung zusammenzubringen.
Das nächste Seminar findet bereits im November 2025 statt. Weitere Informationen gibt es hier: www.i-tds.de/termine.